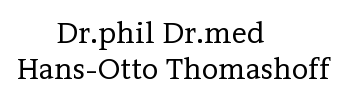Hans-Otto Thomashoff ist Psychiater, Psychoanalytiker und Psychotherapeut in eigener Praxis in Wien. Zahlreiche Vorträge und Veröffentlichungen zu psychodynamischen Verstehenszugängen von Kunst und Kreativität. Er ist Ehrenmitglied des Weltpsychiaterverbandes, Ehrenpräsident der Sektion für Kunst und Psychiatrie des Weltpsychiaterverbandes, wissenschaftlicher Beirat in der Sinnstiftung Gerald Hüthers und Aufsichtsrat der Sigmund-Freud-Privatstiftung. Zudem ist er Autor von Romanen und von Sachbüchern, in denen es um die gesellschaftlichen Konsequenzen geht, die sich aus einer Integration von aktueller Hirnforschung und Psychoanalyse ableiten lassen, aber zugleich auch um praktische Tipps für den Alltag eines jeden Einzelnen von uns.
Wenn Sie meine Bücher interessieren, können Sie sie gerne bestellen bei dem Buchhändler Ihres Vertrauens vor Ort, direkt beim Verlag oder bei:
- amazon.de
- buchhandel.de
- iBooks
- hugendubel.de
- mayersche.de
- mybook.de
- osiander.de
Sachbuch

Kursbuch 216: Manipulieren und Manipuliert-Werden, 2023


Was ist wirklich wichtig im Leben?: So vermitteln Eltern ihren Kindern Werte, 2021

Damit aus kleinen Ärschen keine großen werden: Warum Eltern die besten Vorbilder sind, 2018

Das gelungene Ich: Die vier Säulen der Hirnforschung für ein erfülltes Leben, 2017

Hörbuch (Links mit Hörprobe)
Damit aus kleinen Ärschen keine großen werden: Warum Eltern die besten Vorbilder sind, 2021
Was ist wirklich wichtig im Leben?: So vermitteln Eltern ihren Kindern Werte, 2021
Roman
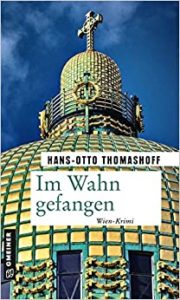

Die Notizen des Doktor Freud, 2004

Interviews (Auswahl)
Lasst uns statt Glück die Zufriedenheit suchen!
Immer schöner, immer reicher, immer besser – das ständige Streben nach dem Kick bestimmt unser Leben. Der Psychoanalytiker Hans-Otto Thomashoff sagt, wonach wir wirklich streben sollten.
Von Claudia BeckerRedakteurin
Die Welt: Zufriedenheit ist das neue Glück, sagen Sie. Das klingt irgendwie behäbig. Jedenfalls nicht besonders aufregend.
Hans-Otto Thomashoff: Da verwechseln Sie Zufriedenheit mit Genügsamkeit. Zufriedenheit, wie ich sie meine, erfordert sehr viel Aktivität. Denn ich muss mir erst einmal meine Bedürfnisse bewusst machen und dann aktiv dafür sorgen, dass sie befriedigt werden.
Die Welt: Ist das nicht genau das, was wir unter Glück verstehen?
Thomashoff: Es gibt einen großen Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit. Das bestätigt auch die moderne Gehirnforschung. Glück ist immer etwas Flüchtiges. Ein Zustand, der in Erwartung von etwas entsteht, der uns zu einer Handlung bewegen soll. Im Gehirn wird dazu ein Bereich aktiviert, in dem der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet wird. Es kommt zu einem Feuerwerk, das aber schnell abbrennt. Zufriedenheit ist etwas völlig anderes. Sie entsteht, wenn die Bedürfnisse, die wir haben, auf Dauer weitgehend befriedigt werden. Dazu dienen langsam wirkende Belohnungsstoffe, vor allem: Morphium und Endorphine.
Die Welt: Eine Gehaltserhöhung am Montag, ein erfolgreiches Geschäft am Mittwoch, die neue Liebe am Wochenende – kann das wiederholte Glück nicht auch zu einem Dauergefühl der Zufriedenheit führen?
Thomashoff: Ja, aber! Denn es ist wie mit allen Dingen, die sich ständig wiederholen: Sie werden langweilig. Es ist wie bei einer Sucht: Die Intensität der Wirkung nimmt ab. Interessanterweise sind die Gehirnzentren, die an Drogensucht beteiligt sind, dieselben, in denen das schnelle Glück entsteht. Damit können wir im Streben nach dem ständig neuen Glück zu regelrechten Junkies werden. Und das macht natürlich Stress und unzufrieden: Denn andauernd Glücksgefühle zu produzieren ist ganz schön anstrengend.
Die Welt: Was macht uns denn wirklich zufrieden?
Thomashoff: Das sind im Wesentlichen drei Grundbausteine. An erster Stelle stehen gute Beziehungen. Partnerschaften, Freundschaften, selbst zu Haustieren. Immer gilt: Ohne gute Beziehungen ist es schwierig, glücklich zu sein. Der zweite Baustein ergibt sich aus der uns angeborenen Neugier. Wir wollen eigenständig etwas bewirken, selbst etwas schaffen. So wie bei dem Kleinkind, das glücklich strahlt, weil es zum ersten Mal selbst laufen kann. Und als Drittes schließlich ist ein gesunder Stresshaushalt essenziell.
Die Welt: Und was sind die wesentlichen Faktoren, die unser Leben vergiften?
Thomashoff: Dabei geht es vor allem um unnötigen Stress. Der entsteht einerseits durch ungelöste Konflikte, bewusste oder unbewusste, und andererseits durch unverarbeitete psychische Traumen. Das sind Erlebnisse, bei denen die Gefühle so intensiv sind, dass wir sie nicht verdauen können. Diese Gefühle werden daher abgespalten und leben als Dauerstressfaktoren weiter, manchmal ein Leben lang. Durch einen Trigger, einen Schlüsselreiz, können sie jederzeit wieder aktiviert werden. Das funktioniert über die sogenannten Spiegelzellen. Jede einzelne Handlung, die wir im Laufe unseres Lebens lernen, wird nämlich in einer einzelnen Spiegelzelle gespeichert. Das Entscheidende daran ist, so meine These, dass nicht die Handelnden, Subjekt und Objekt, die primär Gespeicherten sind, sondern eben die Handlung selbst. Aus diesem Grund besteht die so paradox erscheinende Gefahr, dass gerade Opfer von Traumen selbst zu Tätern werden: weil sie eben das Handlungsmuster gespeichert haben.
Die Welt: Reduzieren Sie den Menschen nicht zu sehr auf biochemische Vorgänge?
Thomashoff: Das sicher nicht. Ich versuche nur, auf die Spur der Mechanismen zu kommen, die wir sozusagen als Hardware besitzen, um unsere Software nutzen zu können. Die Psyche des Menschen ist genauso wenig das Produkt biochemischer Vorgänge, wie die Rillen auf der Schallplatte die Musik sind. Das Neuro-Biochemische ist nur Mittel zum Zweck, um die andauernd auf uns einwirkenden Umweltinformationen zu speichern und uns dadurch einen Reim auf die Welt „da draußen“ zu machen. Dabei ist faszinierend, wie unglaublich interaktiv wir sind. Unsere Hirnstruktur baut sich immer nur aus der Wechselwirkung mit der Umwelt auf, zu der aus der Sicht des Gehirns auch unser eigener Körper zählt. Deswegen werden auch selbst eineiige Zwillinge nie gleich sein, wird es nie einen kompletten Klon geben.
Die Welt: Wenn Sie sagen, dass gute Beziehungen ein wesentlicher Baustein für ein glückliches Leben sind, drängt sich die Tatsache auf, dass es um unser Beziehungsleben eigentlich nicht besonders gut steht. Wir sind eine Single-Gesellschaft. Viele Beziehungen sind nicht so, wie man sie sich wünscht. Sind wir unglücklich?
Thomashoff: So pauschal nicht, aber wir laufen Gefahr, dass immer mehr von uns unglücklich leben. Es ist doch bemerkenswert, dass die jüngste OECD-Studie zur Zufriedenheit für Deutschland eine Besonderheit erkannte: Trotz der Tatsache, dass es uns im weltweiten Vergleich in materieller Hinsicht überdurchschnittlich gut geht, liegt bei uns die subjektive Lebenszufriedenheit unter dem Schnitt. Grund dafür ist der zunehmende Dauerstress. Da ist es kein Zufall, dass Depressionen so drastisch zunehmen, dass sie inzwischen die höchsten Kosten von allen Krankheiten verursachen. Daran sind nicht die Gene schuld, sondern die Art, wie wir leben. Eigentlich sind wir Menschen ja, salopp gesagt, immer noch Primaten. Und die leben fast alle in bunten Familienverbänden. Ein Junges, das da hineingeboren wird, hat A eine Mutter, die es die ganze Zeit bei sich trägt, und B eine Vielfalt an anderen Beziehungen. Genauso leben ja auch die meisten Menschen weltweit. Nur wir nicht mehr. Wir haben Single-Haushalte, sind alleinerziehend, schieben alte Menschen ab. Das entspricht gar nicht unserer Natur.
Die Welt: Aber das ist nun mal die Realität unserer modernen Gesellschaft. Und haben nicht die meisten irgendwelche traumatischen Erfahrungen im Gepäck? Sind wir verdammt, unglücklich zu sein?
Thomashoff: Ebenfalls ein klares Nein. Eine interessante Studie belegt das, für die mehr als 40 Jahre lang auf der Insel Kauai Kinder aus völlig desolaten Verhältnissen beobachtet wurden. Das Ergebnis bot eine Überraschung. Ein Drittel der Kinder wurde überhaupt nicht auffällig. Sie schienen immun zu sein gegen die Umwelteinflüsse, standen ganz normal im Leben. Eines hatten sie alle gemeinsam: zumindest eine stabile, gute Beziehung. Die lieferte die Grundlage für ein Urvertrauen und für die Erfahrung: Auch Schwieriges kann ich überstehen! Irgendwie kriege ich das schon hin! Denn eine Krise, die gut überwunden wird, ist kein Trauma. Und die stärkste Macht, die eben das Überstehen ermöglicht, ist der vertraute andere. Dann wird Lernen am Erfolg in unserem Gehirn belohnt. Und dabei ist das Erfolgserlebnis größer, wenn ich ein schwieriges Rätsel löse, als wenn ich ein leichtes Rätsel löse.
Die Welt: Brauchen Kinder mehr Stress, um später zufrieden zu werden?
Thomashoff: Anforderungen sind gut. Aber ein Zuviel an Reizen ist schädlich. Das Gehirn braucht ja Zeit, um Eindrücke zu verarbeiten. Wenn es diese Zeit nicht hat, weil ständig neue Reize hinzukommen, dann fehlt die Möglichkeit, etwas zu entwickeln und wirklich zum Abschluss zu bringen, um dann den Erfolg in Ruhe zu genießen.
Die Welt: Kindern möglichst viele Aktivitäten und Aufgaben anbieten, das ist das eine, was moderne Helikopter-Eltern ausmacht. Das andere ist, alles Unangenehme von ihnen fernzuhalten.
Thomashoff: Auch das ist leider schlecht, weil dann das Bedürfnis, selbst etwas zu bewirken, zu kurz kommt. Überbehütet bleiben Kinder ewig in den Kinderschuhen stecken. Ihnen fehlt das Lernen am Erfolg, das sich einstellt, wenn man selber etwas schafft. Die Aufgabe von Erziehung muss doch darin bestehen, auf das wirkliche Leben vorzubereiten. Und das geht am besten am echten vorgelebten Vorbild.
Die Welt: Wie kann ich an meiner eigenen Zufriedenheit arbeiten?
Thomashoff: Zunächst einmal muss ich ein Bewusstsein dafür schaffen. Ich muss meine Gefühle, vor allem auch meine dunklen Seiten, meine Aggressionen, erkennen, verarbeiten und möglichst nutzen lernen. Dann muss ich damit anfangen, meine Konflikte aufzuräumen. Und zwar die, die mir bewusst sind, ebenso, wie die, die tiefer liegen. Wenn ich das selbst nicht schaffe, ist durchaus professionelle Hilfe empfehlenswert. Schließlich sollte ich mich aktiv darum bemühen, gute Beziehungen zu haben, und mir ein Betätigungsfeld suchen, in dem ich selbst etwas schaffen, in dem ich mich verwirklichen kann, allerdings ohne, dass das in zu viel Stress ausartet.
Die Welt: Das klingt nach ganz schön viel Arbeit …
Thomashoff: Ich habe ja gesagt, dass ein zufriedenes Leben alles andere als langweilig ist. Es ist erfüllt! Ist das nicht wunderbar, dass der Mensch es eigentlich selbst im Griff hat, glücklich zu werden?
Die Welt: Vielleicht können Sie trotzdem noch einen ersten einfachen konkreten Schritt mitgeben.
Thomashoff: Leben Sie Beziehung. Lieben Sie! Der erste Schritt kann ein Lächeln sein. Der Psychologe Paul Ekman hat herausgefunden, dass sich unsere Mimik bewusst trainieren und dadurch nutzen lässt. Unwillkürlich heben wir mit einem Lächeln unsere Stimmung. Und die eines anderen auch, denn am besten funktioniert das, wenn die Spiegelzellen gefordert werden, weil uns jemand anlächelt und wir sein Lächeln erwidern. Nicht nur Lächeln, auch Zufriedenheit ist dann ansteckend.
http://www.welt.de/vermischtes/article134870810/Lasst-uns-statt-Glueck-die-Zufriedenheit-suchen.html
Zufriedenheit bringt mehr als Glück Glück währt nur einen Moment, sagt Psychiater Hans-Otto Thomashoff
Wer regelmäßig in den Ratgeber-Abteilungen der Buchhandlungen stöbert, weiß: kein Thema ist so präsent wie Glück. Glück im Alltag, Glück in der Liebe, Glück im Job. Was bedeutet Glück? Wie finde ich es? Und, noch wichtiger – was muss ich tun, damit es mich nicht verlässt?
Fragen, die sich die Menschen eigentlich nicht zu stellen bräuchten, findet Hans-Otto Thomashoff. Der Psychiater und Psychoanalytiker plädiert dafür, Glück als Lebensziel Nummer 1 zu ersetzen. Und zwar durch Zufriedenheit. „Alle Menschen wollen glücklich sein. Und sitzen dabei einem Irrglauben auf: Glück ist flüchtig. Anders die Zufriedenheit. Zufriedenheit ist das eigentliche Glück. Sie kann von Dauer sein“, sagt der gebürtige Deutsche, der in Wien eine Praxis betreibt. Warum und wie das gelingt, beschreibt Thomashoff in seinem neuen Buch „Ich suchte das Glück und fand die Zufriedenheit – Eine spannende Reise in die Welt von Gehirn und Psyche“.
Quellen für mehr Zufriedenheit
- Frühe, stabile Bindungen
Mit der Geburt verlässt das Kind sein „Paradies“ – einen Ort ohne Hunger, Stress, Durst – und kommt in eine Welt, in der es plötzlich mit negativen Gefühlen konfrontiert wird. „Diese frühe Zeit wird dann erträglich, wenn eine Bindung da ist, im Normalfall mit der Mutter“, so Hans-Otto …
Zufriedenheit hat ein Image-Problem: Sie ist nicht sehr sexy. Das Wort allein vermittelt keine ekstatischen Glücksgefühle, keinen Kick. „Zufrieden sein“ klingt unspektakulär, ein wenig nach Stillstand. Nach altem Opa, der im Schaukelstuhl wippend auf sein Leben zurückblickt.
Glückssuche stresst
Dabei hat die Hirnforschung längst bestätigt, dass Glück im Gegensatz zu Zufriedenheit kein dauerhafter Zustand sein kann. Thomashoff liefert die biochemische Begründung: „Glück wird von dem Transmitter (ein Botenstoff, Anm.) Dopamin gesteuert, der dann ausgeschüttet wird, wenn ein positives Ereignis erwartet wird. Zuerst gibt’s ein kurzes Feuerwerk, dann verebbt das Ganze. Wenn ich diesem Glück dauernd nachhetze, bin ich irgendwann gestresst und keineswegs zufrieden.“
Ist man zufrieden, tritt ein „Belohnungseffekt“ ein, wenn die Bedürfnisse von Körper und Psyche gestillt sind. Dieser Effekt wird durch Endorphine und Morphine (körpereigene Schmerzmittel) ausgelöst und dauerhaft hergestellt. „Zufriedenheit bedeutet, etwas erreicht zu haben, in guten Beziehungen zu leben, und das dauerhaft.“
Der Psychiater erläutert, welche seelischen Bedürfnisse für ein zufriedenes Leben gedeckt sein müssen. Zwei essenzielle Bausteine gibt es, eine wurde schon erwähnt: gute, stabile Beziehungen pflegen, idealerweise von Geburt an, und, zweitens, aus eigenem Antrieb etwas bewirken. „Das führt im Gehirn eher zu einem Belohnungseffekt als der reine Genuss.“
Der dritte Baustein ist nach Thomashoff ein ausgeglichener Stresshaushalt. „Wenn ich diese drei Bereiche abdecke, ergibt sich ein gutes Leben von selbst. Die oft gepriesene Suche nach dem Sinn des Lebens erübrigt sich. Ich habe festgestellt, dass bei den Leuten, die nach Sinn suchen, einer dieser drei Bereiche nicht passt.“
Stimmungskiller
Wer zu viel Stress hat, sollte sich fragen: Wie stressempfindlich bin ich? „Manche Leute haben ein dickes Fell – wahrscheinlich jene, die früher eine stabile Beziehung zu jemandem hatten.“ Wer weniger stress-resistent ist, muss achtsamer mit seiner Belastbarkeit umgehen. Thomashoff, prägnant: „Pausen schaffen, Stressfaktoren strukturieren“.
Bei ewig Unzufriedenen findet sich fast immer das Fehlen einer verlässlichen Bindung in ihrer frühen Kindheit, sagt Thomashoff. Vor allem, wenn es Schockerlebnisse gab. „Die Killer der Zufriedenheit sind Konflikte und unverarbeitete Traumata. Ein Trauma ist ein so heftiges Erlebnis, dass die Gefühle zum Zeitpunkt des Erlebten nicht verdaut werden können. Sie können aber jederzeit hervorbrechen. Menschen, die so ein Trauma erlitten haben, haben eine deutlich erhöhte Stressempfindlichkeit.“
Bedeutet Zufriedenheit Stillstand im Kopf? Thomashoff: „Keineswegs. Zufriedenheit rekrutiere ich ja aus einem lebendigen Beziehungsleben. Zudem will man ja immer etwas Neues aktiv bewirken. Das ist das Gegenteil von Stillstand!“
http://kurier.at/lebensart/leben/psychiater-hans-otto-thomashoff-erklaert-warum-zufriedenheit-mehr-bringt-als-glueck/90.403.906 (Kurier) 12.10.2014
Aggression ist kein menschlicher Trieb
VON S. WINKELNKEMPER
Herr Thomashoff, kommen wir gleich zum Kern ihrer Arbeit: Sind wir Menschen von Natur aus böse? Oder werden wir dazu gemacht? Thomashoff Nein, wir sind nicht automatisch böse. Aggression ist kein menschlicher Trieb. Damit widersprechen Sie Konrad Lorenz und Sigmund Freud. Liegt es nicht nahe, an einen Trieb zu glauben, wenn sich schon Kleinkinder schreiend auf den Boden werfen? Thomashoff Das ist das große Missverständnis. Ein wütendes Kind ist nicht aus heiterem Himmel heraus wütend, sondern weil es irgendwie frustriert wird: weil es etwas nicht durchsetzen kann oder weil es Schmerzen hat zum Beispiel. Kindergefühle sind heftiger als die von Erwachsenen, weil sie noch nicht reflektiert sind. Wenn ein Kind etwa zur Mutter sagt: ,Ich hasse dich’, dann glaubt es das in dem Moment, auch wenn es fünf Minuten später wieder sagt: Mama, ich hab dich lieb. Wie sprechen hier von Spaltung. Aufgabe der Bezugspersonen ist es, diese Gefühle dem Kind verständlich zu machen: ,Ich verstehe dich, teile deine Wut aber nicht und weiß, dass sie vorübergeht.’
Versuchung des Bösen – So entkommen wir der Aggressionsspirale
Peter Schipek im Gespräch mit Prof. Dr. Dr. Hans – Otto Thomashoff
„Wohin wir auch schauen: Krieg, Gewalt und Zerstörung. Das Böse hält die Menschheit seit jeher in Atem und scheint fortwährend neue Nahrung zu bekommen. Bleiben wir dieser Dynamik für immer ausgeliefert? „Nein“, sagt der Psychoanalytiker Hans – Otto Thomashoff und rüttelt mit seinen Erkenntnissen an unserem gewohnten Denkbild. Denn radikal neue Denkansätze zeigen, wie wir der Aggressionsspirale entkommen können. Ein Schlüsselfaktor dabei ist die Umwertung von Aggression. Wird sie nicht ausschließlich destruktiv gesehen, sondern auch ihr konstruktives Potenzial anerkannt, so besteht die Aussicht, dass zerstörerische Aggressivität sich selbst und anderen gegenüber durch neue und bessere Handlungsstrategien ersetzt werden kann.“
Peter Schipek: Aggression hat einen schlechten Ruf. „Du bist aggressiv“ – für viele Menschen eine eindeutig negative Bewertung. Sie zeigen uns in Ihrem Buch, dass es eine positive Seite von Aggression gibt. Ist Aggression auch ein Weg sich selbst besser kennen zu lernen?
Hans-Otto Thomashoff: Aggression ist ein Teil unserer ganz normalen psychischen Ausstattung und damit Teil jeder Selbsterkenntnis. Wenn ich mir meine Gefühle eingestehe, bin ich besser in der Lage, sie auch nutzen zu können, anstatt ihnen mehr oder weniger ausgeliefert zu sein. Prinzipiell ist Aggression eine evolutionär sinnvolle Errungenschaft als Reaktion auf Frustration. Sie dient der Überwindung von Hindernissen jedweder Art und ist damit vom Ursprung her konstruktiv. Kein Mensch ist frei von ihr. Doch es bleibt eben die Frage, wie es zur Entstehung von übermäßiger, von destruktiver und pathologischer Aggression kommt.
Peter Schipek: Viele Wissenschaftler sind seit einiger Zeit bemüht, Erklärungen für die wachsende Aggressions- und Gewaltbereitschaft zu finden. Es gibt umfangreiche Veröffentlichungen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Sie zeigen in Ihrem Buch, was man unter Aggression versteht, wie sie sich entwickelt und wie man der Aggressionsspirale entkommt. „Der Schlüssel dabei ist die Umwertung von Aggression. Wir müssen das positive Potenzial der Aggression anerkennen.“ Wie lässt sich der konstruktive Umgang mit Aggression lernen? Wie kann uns konstruktive Aggression vorwärts bringen?
Hans-Otto Thomashoff: Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass zwei wesentliche Bausteine unsere Psyche formen: erstens die Beziehungen, die wir erleben, und zweitens unser Bedürfnis nach Entfaltung, nach dem Austesten unserer Grenzen: Wie weit kann ich gehen? Warum sonst klettert jemand ohne Sauerstoffgerät auf einen 8000er? Die ganze Menschheitsgeschichte, unsere kulturelle Evolution, lässt sich als Ausdruck dieses Strebens verstehen. Wird dieses fundamentale Grundbedürfnis nach Entfaltung gehemmt, so reagieren wir mit Aggression, und wenn die sich dann aufstaut, entstehen Gewaltpotenziale – Stichwort Jugendarbeitslosigkeit. Erkenne ich dieses Grundbedürfnis hingegen an, so kann ich sowohl als Einzelner ganz gezielt in meinem Alltag für mehr Zufriedenheit sorgen, als auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene Rahmenbedingungen hierfür schaffen. Dort aber, wo sich Aggression angestaut hat mit dem Potential destruktiv zu werden, sollte ich therapeutisch ansetzen. Unsere Hirnstruktur ist und bleibt zumindest in Teilen modifizierbar. Unverzichtbares Vehikel für ihre Beeinflussung ist die menschliche Beziehung. Am Spiegelzellsystem konnte belegt werden, wie fundamental das menschliche Gehirn zwischen belebten und unbelebten Objekten unterscheidet. Da zudem bekannt ist, dass Gefühle dann einer Bearbeitung zugänglich sind, wenn sie aktiviert werden, lautet die Konsequenz: Aggression zum Thema machen, etwa in einer Therapie einem aggressiven 2 Patienten deutlich machen, dass man ihn versteht und zugleich klar in seinem Verhalten zu begrenzen. Für mich ist hier der Vergleich mit einem Kleinkind hilfreich, dem, wenn es einen Wutanfall hat, sinnvollerweise signalisiert wird: „Ich verstehe dich, teile deine Wut aber nicht und weiß außerdem, dass sie vorübergehen wird.“
Peter Schipek: Vielen Menschen mangelt es an „positiver Aggression“. Sie verdrängen ihre Wut, ihren Ärger, ihre Ohnmacht. Sie haben beschnittene oder keine Handlungsspielräume, würden am liebsten auf den Tisch hauen – nach dem Motto: „Mit mir nicht“. Aber sie wissen genau: im Zweifel würden sie sich nur Konflikte einhandeln. Fordert verdrängte Aggressivität nicht einen hohen Preis? Wie können Menschen in solchen Situationen handeln?
Hans-Otto Thomashoff: In der Tat ist bei andauernder Verdrängung von Aggression ein hoher Preis zu zahlen, nämlich der schwerer Depressionen, die nicht umsonst heutzutage so zugenommen haben, dass die WHO sie inzwischen als kostspieligste aller Erkrankungen ansieht. Ich zitiere hierzu führende neurobiologische Psychiater: „Zwischen einer fehlerhaften Funktion des serotonergen Systems und impulsiver Aggression konnte eine Verbindung nachgewiesen werden. Dies betrifft sowohl die Autoaggression, wie etwa bei Suizidversuchen, als auch Fremdaggression, etwa Wutausbrüche oder Gewalt.“ Es kommt noch klarer: Es „liegen Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen serotonergen Defiziten und impulsiver Aggression vor.“ (Siever, L. J.) Exakt dasselbe neurobiochemische Defizit findet sich also bei Aggression und Depression! Entsprechend „ließ sich in Tierversuchen zeigen, dass [die] Zerstörung serotonerger Neurone zu ungehemmter Aggression führt.“ ( Köhler, T ) Hier wird verständlich, warum in der Psychiatrie die vermeintlich überraschende Beobachtung gemacht wird, dass Aggressivität und Ärgerattacken häufig begleitend zu Depressionen auftreten. Beide sind ursächlich identisch und lediglich ihrer Ausrichtung nach verschieden (gegen sich oder gegen andere). Hochbrisant sind in diesem Zusammenhang auch neueste Forschungsergebnisse, die den Schluss nahe legen, dass die medikamentöse Behandlung einer Depression die Rückfallwahrscheinlichkeit erhöht (!), eine angemessene Psychotherapie hingegen, indem sie an den ursächlich verantwortlichen Nervenzellnetzwerken ansetzt und darüber nachweislich auch den Serotoninspiegel normalisiert, das Risiko einer erneuten Erkrankung senkt, wie jüngst belegt werden konnte. Doch die Bedeutung der Aggression für das Verständnis psychischer Erkrankungen reicht noch weiter. Neben Essstörungen („Mir ist zum Kotzen“) können auch Panikattacken und Angstanfälle, auf psychoanalytischen Modellen fußend, zumindest partiell als Äußerungsform von Aggression verstanden werden. Sie wird in diesem Fall unbewusst auf die Umwelt projiziert, wodurch der folgenschwere unbewusster Kreislauf in Gang kommt, den wir schon beim Menschen in der Masse kennen lernen konnten: Wenn die anderen so wütend sind, wie ich selbst es bin, dann muss ich verdammt auf der Hut sein. Außerdem ärgert mich das, wodurch meine Wut noch größer wird (mit dem Ergebnis, dass auch das Ausmaß meiner Projektion zunimmt). Die Auflösung einer solchen Dynamik kann einen Patienten (nach eigener Erfahrung in den meisten Fällen) von seiner quälenden Symptomatik befreien.
Peter Schipek: Ist konstruktive Aggressivität also ein „Kraftwerk“ für uns? Brauchen wir sie, um für unsere Ziele zu kämpfen, uns zu behaupten?
Hans-Otto Thomashoff: Wir brauchen Räume oder Spielwiesen, um uns entfalten zu können, und Aggression ist, wie ich beschrieben habe, die Kraft, die uns hilft, Hindernisse bei unserem Streben nach Entfaltung zu überwinden. Sie ist demnach primär eine konstruktive Kraft, die erst destruktiv wird, wenn sie ihren eigentlichen Zweck nicht erfüllt und sich quasi frustriert anstaut.
Peter Schipek: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass bereits vorgeburtliches Erleben in unserer Hirnstruktur gespeichert wird und Stress vor der Geburt zeitlebens zu einem höheren Aggressionspotenzial führt. Lassen sich manche Probleme von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen erst verstehen und lösen, wenn wir auch die im Mutterleib gemachten Erfahrungen berücksichtigen?
Hans-Otto Thomashoff: Das ist in der Tat ein ganz wesentlicher, bislang komplett unbeachteter Bereich. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass eine Mutter, die sich in der Schwangerschaft in extremen Stresssituationen befindet, ein latent aggressiveres Kind haben wird. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass es auf unserem Planeten Gebiete gibt, in denen immer wieder Kriege aufflammen, könnte das eine mögliche Mitursache dafür sein. Wie das? Auf der Basis der genetischen Vorgaben entsteht das anatomische Grundgerüst des Gehirns im Mutterbauch, wo sich unmittelbar daran anschließend spätestens ab dem dritten Schwangerschaftsmonat außenreizabhängig (!) das eigentliche Nervenzellnetzwerk auszubilden beginnt. Ohne Außenreize fände keine Vernetzung statt. Als Beispiel hierzu sei auf blind geborene Kinder verwiesen, deren ZNS, wenn nicht bis zum sechsten Lebensjahr eine Korrektur der Sehstörung erfolgt, unweigerlich blind bleiben, weil keine entsprechende Vernetzung im Gehirn ausgebildet worden ist. Belege für vorgeburtliche Wahrnehmungsaktivitäten von Feten liegen vielfältig vor: im fünften Monat kann der Fötus schmecken, im sechsten hören, im siebten sehen. Auch der Homunkulus ist Ausdruck des frühen außenreizabhängigen Aufbaus der Hirnstruktur. Die in der sensiblen Hirnrinde repräsentierte vermeintlich unanatomische Nähe von Gesicht und Händen sowie Füßen und Becken spiegelt schlicht die Position des Fetus wider. Schon hier beginnt hirnbiologisches Lernen. Jede neue Information kann im Gehirn nur auf der Basis der bereits bestehenden Struktur gespeichert werden, modifiziert diese, wird aber auch von ihr beeinflusst. Daraus folgt nicht nur, dass frühzeitig angelegte Hirnstrukturen das spätere Lernpotenzial in sämtlichen Bereichen bestimmen, sondern auch, dass frühe Einflüsse potenziell stärker in ihren Auswirkungen sind. Neurochemische Basis übermäßiger Aggression ist die Aktivierung aggressiver Gene durch Kortisol, das heißt Stress resultiert in gesteigerter Aggressivität in der Hirnstruktur. Das gilt nicht nur für das erwachsene oder das kindliche Gehirn, sondern eben bereits vorgeburtlich und beeinflusst so das angeborene (aber nicht notwendigerweise genetisch verursachte) Temperament.
Peter Schipek: Wenn wir also den Satz „Die Zukunft sind unsere Kinder“ ernst nehmen, dann gibt es keine wichtigere Aufgabe, als sich um die Verbesserung der Lebensbedingungen für unsere Kinder zu kümmern. Das gilt dann aber nicht erst für die Phase der frühen Kindheit, sondern auch schon für die vorgeburtliche Entwicklung.
Hans-Otto Thomashoff: Absolut ja. Die Vermeidung von übermäßiger Stressbelastung in der Schwangerschaft und während der Geburt scheint mir dringend geboten, wenn sich langfristig fundamental etwas ändern soll. Das reicht von Extrembelastungen für die Mutter, sei es in Beruf, Partnerschaft oder durch äußere Faktoren wie Kriege oder Katastrophen, bis hin zu den möglichen Auswirkungen vorgeburtlicher invasiver Untersuchungsmethoden beziehungsweise von Eingriffen in den Geburtsverlauf selbst. Man sieht hier gut, wie zwar einzelne Einflussfaktoren aus heutiger Sicht noch absolut utopisch sind, jedoch andere konkrete Maßnahmen sich leicht umsetzen lassen würden.
Peter Schipek: Aggressionen von Kindern werden von Eltern und Erziehern häufig als störend oder bedrohlich erlebt. Wenn sich Kinder wütend, zerstörerisch, rücksichtslos, beleidigend oder provokant verhalten, dann sind Erwachsene oft verunsichert und stehen dem Problem hilflos gegenüber. Sie wissen nicht, wie sie mit der Aggressivität ihrer Kinder umgehen sollen. Was brauchen Kinder, um eine gesunde, konstruktive Aggression zu lernen?
Hans-Otto Thomashoff: Wie auch immer die Mutter mit der frühen Aggression ihres Kindes umgeht, die Interaktion zwischen beiden wird in der Hirnstruktur des Kindes verankert, und sein zukünftiges Handeln erfolgt auf der Basis dieser verinnerlichten Muster. Das Wutpotential als Kraft zur Frustrationsüberwindung und zur Bestätigung der eigenen Wirkmächtigkeit wird auf der Basis dieser frühen Beziehung gestaltet und entwickelt sich zu einem weitgehend unbewussten Modell von Aggression als Teil der eigenen Identität, über dessen Handlungsvarianten im optimalen Fall frei verfügt werden kann. Das heißt, die Eltern sind unweigerlich Vorbild für den Umgang des Kindes mit seiner Aggression. Da eben alle späteren Erfahrungen auf den vorangegangen aufbauen, und da die wesentlichen Hirnstrukturen bis zum sechsten Lebensjahr etabliert sind, verwundert es nicht, dass die frühen Aggressionsformen und Bindungsmuster auch im Erwachsenenalter erhalten bleiben. So wurde in der Bindungsforschung belegt, dass früh unsicher gebundene Kinder im Vergleich zu sicher gebundenen als Erwachsene eine deutlich höhere Neigung zu feindseliger Aggression aufweisen. Ja, es konnte sogar eine regelrechte Hochrisikogruppe für die Ausbildung späterer destruktiver Aggression identifiziert werden: die Mischform der desorganisiert vermeidend gebundenen Kinder. Bei ihnen ist die Neigung, ihre Umwelt im Zweifelsfall aggressiv zu interpretieren, besonders ausgeprägt mit dem daraus resultierenden Teufelskreis aus sich selbst bestätigenden Erfahrungen. Das Verständnis solcher Zusammenhänge eröffnet die unschätzbar wichtige Chance auf mögliche Strategien, die der Entstehung schwerer pathologischer Aggression langfristig vorbeugen könnten, denn eine weitere Erkenntnis der Bindungsforschung verweist darauf, dass Bindungsmuster von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Es konnte bewiesen werden, dass das Vorliegen sicherer oder unsicherer Bindungsmuster zwischen Eltern und ihren Kindern in hohem Maß übereinstimmt, was nach den vorangegangenen Ausführungen nicht wirklich überraschen dürfte. Auch die Übertragung traumatischer Erfahrungen von einer Generation auf die nächste konnte belegt werden, inzwischen sogar bis in die übernächste Generation. Die psychische Verflechtung von Trauma als überwältigendem Stressereignis und Aggression ist ausgesprochen eng. Daraus lässt sich schließen, dass eben auch aggressives Verhalten, insbesondere destruktive Aggression, in einem immer aufs Neue angestoßenen Teufelskreis ganz automatisch an nachfolgende Generationen weitergegeben wird, solange es nicht zu einer Durchbrechung dieses fatalen Musters kommt.
Peter Schipek: Neben konstruktivem steckt ja in jedem Menschen auch destruktives Potenzial. Wie lässt sich destruktive Energie in positive Kraft umwandeln?
Hans-Otto Thomashoff: Ich bin mir da inzwischen nicht mehr so sicher, ob wirklich in jedem Menschen auch ein destruktives Potenzial stecken muss. Um das zu erklären, muss ich ein wenig weiter zu dem eben gesagte ausholen und auf die Verbindung zwischen Trauma und Aggression eingehen, da ich hier eine, wenn nicht die zentrale Ursache für pathologische Aggression sehe: Die charakteristische Variante eines Stressexzesses schlechthin ist das akute psychische Trauma. Schon bei Erwachsenen, die einer traumatischen Belastung ausgesetzt sind, lassen sich dauerhafte Folgen finden. Die unweigerlich heftige emotionale Reaktion auf das auslösende Ereignis wird oft abgespalten und ruht dann im Unbewussten, um irgendwann an die Oberfläche zu treten. Selbst Jahre später noch können dann schon einzelne mit dem Trauma verbundene Reize (Bilder, Geräusche, Gerüche) zu einem Auslöser massiver Angst 5 und Panik werden, ohne dass auf den ersten Blick ein Zusammenhang zwischen Anlass und Reaktion ersichtlich ist. Mehr noch: Unter Extremstress kann es selbst zu einem völligen Zusammenbruch der Informationsspeicherung kommen. Das im Anschluss an die akute Mobilisierung mit Adrenalin und Noradrenalin massiv ausgeschüttete Stresshormon Kortisol bewirkt in exzessiv hohen Konzentrationen eine echte Strukturauflösung im Gehirn. Als Folge hiervon lassen sich in Bild gebenden Verfahren regelrechte Defekte im Informationsverarbeitungszentrum der Hirnstruktur nachweisen. Scheinbar zusammenhanglos werden so ausschließlich die emotionalen Inhalte des traumatischen Erlebnisses dauerhaft behalten; das Ereignis selbst ist vergessen! Doch es kommt noch ärger: Neben anderen Neurotransmittern werden zusammen mit dem Kortisol Endorphineausgeschüttet. Zwar macht das wieder einmal Sinn, da akut das Schmerzempfinden ausgeschaltet, die bewusste Wahrnehmung gedämpft und die Motivation stabilisiert wird. Langfristig jedoch kann so eine regelrechte Sucht entstehen. In dem unbewussten Sog danach, wieder den Endorphinkick zu bekommen, neigen schwer traumatisierte Personen dazu, Gefahrensituationen mit dem Risiko eines erneuten Traumas aufzusuchen. Deshalb zieht es nicht nur Täter zur erneuten Tat hin, wenn sie nicht therapiert werden, sondern auch Opfer unterliegen dem fatalen Drang, sich wieder und wieder traumatisieren zu lassen. Die Neurobiochemie der Sucht treibt sie an, und so verwundert es umgekehrt auch nicht, dass Traumaopfer ein erhöhtes Risiko für Suchterkrankungen aufweisen. Auch Drogen geben den ersehnten Kick. Überrascht es da, dass sich bei Drogenabhängigen häufig Hinweise auf traumatische Kindheitserfahrungen finden? Langfristiges neurobiochemisches Korrelat einer posttraumatischen Belastungsstörung ist eine erhöhte Empfindlichkeit des Gehirns gegenüber Kortisol, also gegenüber Stress. Unter normalen Bedingungen bewirkt der körpereigene Regelkreislauf, dass der Kortisolspiegel von nun an besonders niedrig gehalten wird, ein leichter Auslöser kann jedoch jederzeit eine massive Stressreaktion bewirken. Demgegenüber gehen Depressionen mit einer Erhöhung von Kortisol im Blut einher. Die Übersensibilisierung gegenüber ansonsten normalen Kortisolwerten und damit gegenüber ansonsten normaler Stressbelastung könnte folglich eine Ursache für die erhöhte Depressions- und damit auch Aggressionsneigung von Traumaopfern sein. Aus psychodynamischer Sicht schließlich werden die beiden Eckpfeiler der psychischen Entwicklung, Beziehung und Wirkmächtigkeit, durch frühe Traumen in ihren Grundfesten erschüttert. Beziehung, real oder verinnerlicht, versagt dabei, Schutz zu bieten und die Katastrophe zu verhindern; das Vertrauen in ihre Sicherheit geht verloren. In gleicher Weise unterwirft das traumatische Ereignis sein Opfer einer totalen Handlungsunfähigkeit. Nicht selten streben daher in der Kindheit Traumatisierte ein Leben lang danach, sich ihre Wirkmächtigkeit immer aufs Neue zu beweisen. Nur in konstantem Aktionismus bleibt sie greifbar. In Verbindung mit der Wirkung der Endorphine kann ein solcher Bestätigungsdrang regelrecht Suchtcharakter gewinnen und sich dadurch verselbständigen. Das Spektrum reicht hierbei von unstillbarer Gier nach Anerkennung bis hin zu ungehemmter, zerstörerischer Randale und sadistischem Mord, wenn andere Ausdrucksformen scheitern. Das frühere Opfer wird so selbst zum Täter. Dass auf diese Weise Traumen unbewusst und wie von selbst von einer Generation an die nachfolgende weitergegeben werden können, leuchtet ein und ist vielfach belegt. Der eigentlich evolutionär sinnvolle Quantensprung in der Wissensvermittlung durch direkte Weitergabe unabhängig von der genetischen Vererbung resultiert hier in fatalen Konsequenzen. Zur Veranschaulichung zitiere ich eine ihr Kind misshandelnde Mutter, die von sich sagte. „Ich fühlte mich in meinem ganzen Leben nie wirklich geliebt. Als das Kind auf die Welt kam, dachte ich, es würde mich lieben, aber als es die ganze Zeit nur schrie, bedeutete das, es würde mich nicht mögen, also schlug ich es.“ Eine solche Dynamik der fortgesetzten frühkindlichen Traumatisierung könnte ein regelrechtes „Heranzüchten“ pathologisch aggressiver Menschen zur Folge haben, denn wir erinnern uns: Traumen stellen unbewältigten Stress dar, und dieser bildet die Grundlage für übermäßige Aggression. Allerdings müsste frühkindliche Traumatisierung hierzu sehr verbreitet sein. Ist sie das? Die leider schockierende Antwort lautet eindeutig: Ja! 6 Schätzungen zur aktuellen Häufigkeit von Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung sind schlichtweg erschreckend. Eine besonders sorgfältige Studie aus Deutschland, kommt 1997 zu dem Schluss, dass mindestens 8,6% aller Frauen und 2,8% aller Männer Opfer von sexuellem Missbrauch waren. Das ist wohlgemerkt eine absolute Mindestschätzung beim Herausrechnen sämtlicher möglicher Fehlerquellen. Weniger zurückhaltende Annahmen liegen darüber, meist deutlich. So ergaben retrospektive Befragungen in Großbritannien bei Männern, dass 20 – 30% von ihnen körperlichen Misshandlungen ausgesetzt gewesen waren, bei Frauen, dass 25 – 60% Opfer sexuellen Missbrauchs waren; in Deutschland lauten die Zahlen allein für sexuellen Missbrauch: Männer 10-15%, Frauen 20-30%. Eine Anhörung im Mainzer Landtag (1989) ergab, dass etwa „jede vierte Frau vor dem 14. Lebensjahr Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch in der Familie gemacht habe“ (Dulz, B.). Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis lautet: Traumen werden über Generationen hinweg in ewigen Opfer-Täter-Ketten weitergereicht, wenn es nicht zu einer Unterbrechung dieses Kreislaufs kommt. Hier sehe ich die Basis der menschlichen Destruktivität, die damit nicht notwendigerweise unserer Natur entspricht.
Peter Schipek: Einer der Schlüsselpassagen in Ihrem Buch ist das Thema „Wirkmächtigkeit“. Ein Zitat daraus: „Dieses Grundbedürfnis, etwas bewirken zu können, ist das zentrale Element überhaupt zum Verständnis der menschlichen Aggression. Hat ein Mensch das Gefühl, ihm wird diese Wirkmächtigkeit genommen, so reagiert er ausgesprochen aggressiv. Mit der Unüberwindbarkeit von Hindernissen können wir uns eher abfinden als mit dem Gefühl, unserer Handlungsfähigkeit beraubt zu werden.“ Wie können wir selbstwirksames Handeln schon im Kindes- und Jugendalter ermöglichen und fördern?
Hans-Otto Thomashoff: Lassen Sie mich darauf mit einem Gegenbeispiel antworten: Es ist heutzutage ein großes Problem, wenn Eltern aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen so stark eingespannt sind, dass sie ihre Kinder tagtäglich stundenlang vor dem Fernseher oder vor einem Videospiel absetzen und sich selbst überlassen. Die erlernen dann passiven Konsum, und ihr Bedürfnis, selbst etwas tun können, wird im Keim erstickt. Zugleich speichern sich die Bilder von Gewalt nachweislich im Gehirn als potenziell verfügbares Verhalten ab. Die Aggressionen über die reale Hemmung werden nicht ausgelebt stauen sich an, werden innerpsychisch abgespalten und zugleich mit Gewaltbildern gefüttert. Eins solche Spaltung ist typisch für das Denken von Amokläufern. In der realen Welt sind sie meist sehr angepasst und aggressionsgehemmt, in ihrer Phantasiewelt hingegen tobt das Aggressive, bis es dann eines Tages in die Realwelt hereinbricht. Genau das Gegenteil ist es, was Kinder brauchen. Natürlich ist mir klar, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hier reale Grenzen aufzwingen. Aber die gehören diskutiert genauso wie die propagierten Werte: Ist wirklich der Zweit oder Drittwagen wichtiger – man entschuldige angesichts der „Krise“ diesen Hinweis – oder Zeit für die eigenen Kinder? Die brauchen ihre Eltern als Vorbilder – wie ich beschrieben habe, wiederholen sie unweigerlich deren Verhaltensmuster. Zugleich benötigen sie Räume, in denen sie sich frei entfalten, spielerisch ihre Wirkmächtigkeit erleben können. Dabei ist, wenn ich mir die Erfahrung mit meinen eigenen Kindern anschaue, nichts befriedigender, als gemeinsam mit den Eltern Aufgaben zu bewältigen und dabei die Bestätigung zu bekommen: „Das kannst du schon.“ Zum Beispiel lieben es meine Kinder, gemeinsam mit mir zu kochen. Kocht dann einmal aufgrund von realen Frustrationen die Wut hoch, gilt es wieder ein Stück weit Vorbild zu sein und, wie ich es schon sagte, deutlich zu machen: „Ich verstehe dich, teile deine Wut aber nicht und weiß außerdem, dass sie vorübergehen wird.“ So werden selbst heftige Gefühlsstürme mit der Zeit verdaut und es bleibt Raum im Leben für die evolutionär wahrscheinlich jüngere Kraft, die unser Handeln bestimmt, die Liebe, aber die ist ein eigenes weites Feld.
Peter Schipek: Herr Prof. Thomanshoff – herzlichen Dank für das interessante und ausführliche Gespräch.
Dr. phil., Dr. med. Hans-Otto Thomashoff geb. 1964, ist Psychiater, Psychotherapeut und Psychoanalytiker in eigener Praxis sowie promovierter Kunsthistoriker; Ehrenmitglied der World Psychiatric Association und Präsident der dortigen Sektion für Kunst und Psychiatrie; Verfasser zahlreicher Publikationen, u.a. auch begeisterter Krimi-Autor. Er lebt in Wien.
http://www.lernwelt.at/downloads/interview_prof_drdr_thomashoff.pdf
Die Welt: Das gelungene Ich
Interview in DIE WELT vom 03.01.2018:
Die Welt: In wenigen Tagen beginnt das neue Jahr, für das sich die meisten nichts mehr wünschen als Glück und Zufriedenheit. Aber was ist das überhaupt? Glück? Zufriedenheit?
Hans-Otto Thomashoff: Aus Sicht der Hirnforschung sind das Gefühlszustände, die unser Gehirn herstellt. Es verfügt über zwei Belohnungssysteme, ein schnelles, das uns zu Handlungen antreibt, und ein langsames, das uns bei Erfolg belohnt. Hinzu kommt ein Bindungssystem, das uns einen ruhigen Ausgleich von unseren diversen Aktivitäten bietet und damit den entscheidenden Gegenpol zum Stress. Das kurze, flüchtige Glück entsteht vor allem im schnellen Belohnungssystem, die dauerhafte Empfindung von Zufriedenheit in den beiden anderen Systemen.
Die Welt: Hohe Einkommen, gute medizinische Versorgung – wir haben die besten Voraussetzungen, um glücklich und zufrieden zu sein. Trotzdem gehören psychische Erkrankungen zu den Hauptursachen von Arbeitsunfähigkeit. Stimmt was nicht mit den Belohnungssystemen in unseren Köpfen?
Thomashoff: Unsere Gesellschaft ist weit mehr auf die kurzfristige Belohnung ausgerichtet als auf die langfristige Zufriedenheit. Wir jagen ständig nach dem schnellen Kick. Dadurch geraten wir in einen Teufelskreis, weil die Belohnung nur kurz ist und wir deshalb immer mehr brauchen. Ganz wie bei einer Sucht. Nicht von ungefähr sitzen die meisten Süchte im schnellen Belohnungssystem. Die Jagd nach immer neuen Reizen aber ist Dauerstress. Und der macht krank.
Die Welt: Tatsache ist aber doch auch, dass die Anforderungen steigen. Weniger Arbeitnehmer müssen mehr leisten, Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Wie sollen wir das denn alles schaffen, wenn wir nicht über unsere Grenzen gehen?
Thomashoff: Wir können einfach nicht immer so weitermachen. Schätzungen zufolge gehen schon jetzt bis zu 75 Prozent aller Arztbesuche auf Kosten von zu viel Stress. Meist beginnt es mit Gereiztheit und Schlafstörungen. Dann folgt die ganze Palette an Stresserkrankungen: Bluthochdruck, Herzinfarkt, Migräne, Muskelverspannungen, Reizdarm, Magengeschwüre, Burn-out, Depressionen. Die Ursachen sind offenbar chronische Entzündungen an allen möglichen Stellen im Körper. Selbst die Depressionen dürften, wie jüngste Forschungsergebnisse nahelegen, durch solche Entzündungen im Gehirn als Folge von Stress entstehen.
Die Welt: Wie können wir uns dagegen schützen?
Thomashoff: Indem wir uns bewusstmachen, was wir wirklich für unser Wohlbefinden brauchen.
Die Welt: Kann man darüber nicht sein ganzes Leben lang nachdenken?
Thomashoff: Aus Sicht der Hirnforschung gibt es vier Säulen, auf denen unser persönliches Glück ruht. Wenn wir sie berücksichtigen, belohnt uns unser Gehirn mit einem Zustand dauerhaften Wohlbefindens. Neben guten Beziehungen geht es um die Erfahrung, selbst aktiv etwas bewirken zu können. Außerdem brauchen wir das Gefühl von Stimmigkeit.
Die Welt: Was heißt das?
Thomashoff: Das heißt zum Beispiel, dass ich die alltäglichen Herausforderungen als etwas wahrnehme, was Sinn macht und was zu bewältigen ist. Daran knüpft sich die vierte Säule des Glücks: Ein gesunder Stresshaushalt. Alle vier Komponenten hängen eng miteinander zusammen.
Die Welt: Und wie basteln wir uns daraus ein schönes Leben?
Thomashoff: Wie wir diese Komponenten am besten umsetzen, müssen wir selbst herausfinden. Die erste Voraussetzung ist, sich selbst immer besser kennenzulernen und dann entsprechend für eine auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Lebensgestaltung zu sorgen. Die Feiertage könnten eine gute Gelegenheit sein, in sich zu gehen. Aber auch unseren Alltag sollten wir so strukturieren, dass er uns Zeit für bewusste Ruhephasen lässt. Jeder Tag, im Ablauf jeder Woche. Wenn wir auch im Verlauf des Jahres gezielt Urlaubspausen einlegen, können wir Schritt für Schritt dem Ziel näherkommen, unseren Lebensplan insgesamt zu entfalten.
Die Welt: Was können Eltern tun, damit ihr Kind von klein auf lernt, psychisch stabil zu sein?
Thomashoff: Es gibt eine ganz simple Faustregel. Sie lautet innerhalb der ersten eineinhalb bis zwei Lebensjahre unseres Kindes: im Zweifelsfall für die Bindung. Das bedeutet: Alles, was die Bindungssicherheit, also das Urvertrauen unseres Kindes, stärkt, ist gut. Bindung bietet die Basis dafür, dass es für sein ganzes restliches Leben eine Grundsicherheit entwickeln kann.
Die Welt: Und was ist, wenn, wie heute üblich, beide Eltern arbeiten müssen?
Thomashoff: Ich finde es problematisch, wenn in Deutschland jedes dritte Kind im Alter von unter drei Jahren in Kitas untergebracht ist, darunter viele Säuglinge. Selbst wenn eine Mutter bereits früh für einen Teil des Tages durch andere Bezugspersonen ersetzt werden kann, fehlt es diesen Einrichtungen oft an Betreuern- Kinder aber brauchen für die Entwicklung einer gesunden Psyche die Möglichkeit des Spiegelns, d. h. im Gegenüber sich selbst mit seinen Wünschen und Defiziten zu erkennen, Gefühle weiter zu geben und zu teilen. Je weniger Bezugspersonen da sind, desto weniger Gelegenheit gibt es dazu. Gestörtes Sozialverhalten Essstörungen, Selbstverletzungen – ich erkenne häufig einen Zusammenhang zwischen einem Mangel an frühen Bindungen und Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen.
Die Welt: Beziehungen zu anderen Menschen, sagen Sie, sind ein entscheidender Faktor für ein glückliches Leben. Aber sind es nicht letztendlich die zwischenmenschlichen Konflikte, die einen Großteil unseres Stresses ausmachen?
Thomashoff: Dauerkonflikte, die sich nicht lösen oder zumindest klar eingrenzen lassen bedeuten Dauerstress, und der macht uns krank. Da bleibt auf Dauer nur die Trennung. Darüber hinaus aber ist es unbestritten, dass ein liebevolles und harmonisches Miteinander zu Hause der wichtigste Faktor für einen gesunden Stresshaushalt ist. Fehlt das, gibt es natürlich auch Beziehungen außerhalb der eigenen vier Wände. Längst hat die Wissenschaft nachgewiesen, dass soziale Interaktion Wohlbefinden und Gesundheit steigert. Wer sich wohltätig engagiert, verlängert sein Leben deutlicher als wenn er seinen Blutdruck und seinen Cholesterinspiegel auf die empfohlenen Werte senkt.
Die Welt: Was macht die Digitalisierung mit unseren Beziehungen?
Thomashoff: Sie ist eine Gefahr. Denn nur eine echte, direkt gelebte Beziehung ermöglicht lebendiges Spiegeln, Gefühle mit anderen zu teilen. Ein Bildschirm kann das nicht. Genau deshalb vereinsamen wir vor dem PC, selbst wenn wir 5000 Freunde haben. Zugleich werden uns in der virtuellen Welt so hohe Lebensansprüche und Klischees serviert, dass wir da garantiert nicht mithalten können. Das verhagelt die Stimmung und bereitet Stress. Der, wenn überhaupt, nur lässig nebenbei am Laptop arbeitende, glückliche Single, der von Glamourparty zu Glamourparty und von einem Sexabenteuer zum nächsten tingelt, ist weder real noch als Vorbild erstrebenswert. Er entspricht so gar nicht unserer naturgegebenen Lebensweise. Einfühlung als Voraussetzung für ein erfülltes Miteinander wird ersetzt durch narzisstische Bestätigung. Statt Bindung bleibt Shopping. Serien wie „Sex and the City“ treffen den Zeitgeist – und zugleich mitten ins Herz.
Die Welt: Die Hirnforschung zeigt, dass schon ganz früh ganz viel durch äußere Einflüsse im Gehirn passiert. Wie endgültig ist das? Können gute spätere Erfahrungen oder Psychotherapien überhaupt noch etwas ausrichten?
Thomashoff: Absolut ja. Unser Gehirn bleibt ein Leben lang anpassungsfähig. Das bedeutet, wir können bewusst dafür sorgen, dass wir uns weiterentwickeln. Dazu hilft es, wenn wir neue Erfahrungen suchen, um alte Muster auszugleichen. Wir können uns mit Beziehungen umgeben, in denen wir bewusst unterscheiden lernen, welche Gefühle darin alt und welche der aktuellen Situation angemessen sind. Durch das Zulassen von intensiver Nähe bei gleichzeitigem Erkennen unserer dennoch bestehenden erwachsenen Eigenständigkeit kann sogar fehlendes Urvertrauen nachreifen. Selbst im Erwachsenenalter. Durch das Erleben von Geborgenheit ohne Selbstverlust. Gelingt diese Erfahrung, wird dadurch das Leben freier und erfüllter, und selbst frühe psychische Traumen können Weise aufgelöst werden.
Ö1 Punkt Eins vom 17.07.2018: Damit aus kleinen Ärschen keine großen werden
https://oe1.orf.at/programm/20180717/520196
Ö1 Punkt Eins vom 07.05.2021: Rezepte gegen hirnlose Politik
https://oe1.orf.at/programm/20210507/638056/Rezepte-gegen-hirnlose-Politik
Focus-Magazin vom 14.05.2021: Politiker ignorieren, wie der Mensch tickt
Dem Genius Loci können bisweilen selbst jene nicht widerstehen, die sich professionell der Erkundung des menschlichen Unterbewusstseins widmen. Wie sonst lässt sich erklären, dass sich Hans-Otto Thomashoffs Therapeutencouch nur wenige Gehminuten von Sigmund Freuds Praxis in der Berggasse 19 befindet? Seit vielen Jahren praktiziert der gebürtige Kölner als Psychiater und Psychotherapeut in Wien, dem Geburtsort der Psychoanalyse. Thomashoff, 56, schreibt regelmäßig Sachbücher wie „Das gelungene Ich“ oder „Was ist wirklich wichtig im Leben?“. Dieser Tage erscheint sein neuestes Werk, ein Plädoyer für eine gehirngerechtere Politik. Als Therapeut hat Thomashoff mehr denn je zu tun, nur liegen seine Patienten jetzt daheim auf der Couch, und er analysiert über Skype.
Herr Thomashoff, sind Hirnforscher die besseren Politiker?
Eine Regierung braucht keine politikfremden Spezialisten, sondern Politiker, die neben ihrer für das Amt notwendigen Qualifikation auch die Grundlagen der Hirnfunktion kennen und berücksichtigen. Die Demokratie der Nachkriegszeit ist fraglos ein Erfolgsmodell, nie ging es so vielen Menschen so gut wie heute. Aber wir dürfen uns nichts vormachen: Die Unzufriedenheit wächst in breiten Teilen der Bevölkerung und bricht sich Bahn in Gestalt des Wutbürgers, in Politikverdruss, Protest und Populismus. Die Pandemie verstärkt diese Entwicklung nur. Verantwortlich dafür ist die Politik. Fatalerweise ignorieren unsere Volksvertreter, wie der Mensch tickt und welche psychischen Grundbedürfnisse er hat. Deshalb fordere ich: mehr Hirn in die Politik!
Wie sieht eine hirngerechte Politik aus?
Ein Leben, in dem wir uns psychisch wohlfühlen, basiert auf vier Säulen. Wir brauchen ein Beziehungsumfeld aus Freunden und Familie, in dem wir uns geborgen fühlen. Dann müssen wir aktiv selbst etwas bewirken und gestalten können, damit unsere angeborene Begeisterungsfähigkeit nicht verkümmert. Auch das Gefühl von Stimmigkeit in der Gesellschaft ist wichtig, dazu gehören Gerechtigkeit und Sicherheit als Basis. Und als Letztes brauchen wir ein ausgeglichenes Stressniveau. Übersteigt das auf die Dauer ein erträgliches Maß, kochen die Gefühle über. Genau das erleben wir gerade.
In welcher Verfassung sind die Menschen?
In der ersten Phase der Pandemie sind alle zusammengerückt und waren solidarisch. Dieser Mechanismus ist biologisch in uns angelegt, wir sind Hordenwesen, wir brauchen das Miteinander. Das ist jetzt vorbei. Die anfängliche Zustimmung mit der Regierungspolitik schwindet zunehmend. Die Menschen sind wütend, weil ihnen die Politik seit letztem Frühjahr immer wieder Versprechungen gemacht hat, die sie nicht einhalten konnte. Die Impfung gegen Corona ist ein kleiner Schritt, aber sie ist keine Garantie auf ein Ende der Pandemie, da die Gefahr besteht, dass sie nicht vor künftigen Mutanten schützt. Wir müssen lernen, mit Corona zu leben. Das Leben ist und war schon immer lebensgefährlich. Es sterben auch Menschen auf der Autobahn. Und trotzdem fordert niemand Tempo 30. War es nicht erschreckend, wie schnell ein Großteil der Bevölkerung auf einen Teil seiner Grundrechte verzichtet hat, widerspruchslos?
Das klingt verharmlosend.
Ich will die Gefahr, die von der Pandemie ausgeht, nicht kleinreden. Sie ist real und bedroht Leben. Nur hilft uns das permanente Katastrophisieren nicht, dieses irrationale Verhalten und die ganze Hysterie. Es geht immer nur um das Gefühl. Der Verstand gerät ins Hintertreffen. Die Politik handelt aktionistisch, hat keine verlässlichen Perspektiven und richtet sich nach den Umfragewerten aus.
Was hätten Sie anders gemacht?
Ich halte es mit Ingeborg Bachmann: „Die Wahrheit ist dem Menschen zu – mutbar.“
Die Politik hat die Bürger belogen?
Aus eigenem Wunschdenken heraus. Sie hat den Leuten mit jedem Lockdown versprochen: Bald habt ihr es überstanden, haltet euch nur brav an die Vorschriften. Das war ein Riesenfehler. Jetzt sind die Leute frustriert, wütend. Angst und Wut sind starke Gefühle, sie haben die Macht, unser rationales Denken auszuschalten.
Was passiert dann mit uns?
Wir gehen in die Regression, nehmen die vereinfachte Sichtweise eines Kindes ein, das nur Gut oder Böse kennt. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist der Nährboden für Radikalisierung.
Wie nutzen Agitatoren unsere Schwächen für ihre politischen Ziele?
Politisch geschulte Redner setzen am Gefühl an, sie bieten einfache Lösungen für komplexe Probleme an: Ausländer raus, dann haben alle Arbeit. Die Wahlkampfreden von Politikern am politischen Rand sind Lehrbeispiele für Manipulationstechniken. Sie machen sich zunutze, dass, wenn wir unter Stress stehen, unsere emotionalen Impulse stärker sind als unsere Selbststeuerung.
Was passiert dann mit der Gesellschaft?
Die Regression im Stress fördert die Spaltung. Dann heißt es, wir gegen die anderen, das stiftet Identität. In dieser Situation wollen wir einen starken Anführer, damit wir eigene Schwächen nicht spüren. Für den Anführer ist es ein Leichtes, die angestauten Aggressionen auf einen Feind zu richten. Unsere Spiegelneuronen bewirken, dass wir uns von den Gefühlen anderer anstacheln und anstecken lassen, sie verstärken sich wechselseitig, bis hin zu Massenphänomenen.
Sie beschreiben die Dynamik des Nationalsozialismus.
Diktaturen wissen um diesen Automatismus. Sie instrumentalisieren das Phänomen von Spaltung als psychische Triebkraft für ihre Gewaltexzesse.
Sind wir nach jahrzehntelanger Demokratie nicht gefeit gegen Instrumentalisierung?
Ob es uns gefällt oder nicht, in einem entsprechenden Umfeld geraten wir in die Regression. Diesem Prozess können wir jedoch entgehen, wenn wir die Spaltung entlarven. Die beste Strategie gegen radikale Hetzer besteht darin, deren Ideologie offenzulegen.
Wie sollte die Politik dem entgegensteuern?
Indem sie mit Parteien und Gruppierungen an den Rändern den Dialog sucht, solange die sich innerhalb der demokratischen Grundordnung bewegen. Politiker sollten den Mut finden, die Wut der Menschen offen anzusprechen, negative Gefühle zu benennen, um diese zu entschärfen. Schließlich lassen sich Gefühle nicht verbieten, das belegt die Hirnforschung. Aktuell mangelt es den Politikern an Visionen und langfristigen Perspektiven für den gesellschaftlichen Wandel, den wir dringend bräuchten.
Sie gehen mit der Politik hart ins Gericht.
Mein Hauptkritikpunkt ist, dass uns eine konkrete Perspektive hin zu mehr direkter Demokratie fehlt. Viele Bürger haben den Eindruck, dass über ihre Köpfe hinweg regiert wird. Sie dürfen alle vier Jahre ihr Kreuzchen in der Wahlkabine machen, und das war’s. Die Parteien machen da ihr Spiel, die Selbstvermarktung erscheint wichtiger als politische Inhalte. Die Parteiendemokratie wurde als Reaktion auf die Erfahrungen der Nazizeit in bester Absicht etabliert, aber sie ignoriert weitgehend das menschliche Bedürfnis, selbst etwas bewirken zu wollen. Zugleich haben die Bürger kaum einen Einfluss darauf, wer in den Parteien in Spitzenpositionen aufsteigt, wer also für sie zur Wahl steht. Daraus erwachsen Politikverdruss und Resignation. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Bürger gerne aktiver mitbestimmen würde.
„Viele Bürger haben den Eindruck, dass über ihre Köpfe hinweg regiert wird“
Sie glauben, dass die direkte Demokratie die bessere Staatsform darstellt?
Wir sehen an der Schweiz, dass sie weitestgehend gut funktioniert. Die Bürger wachsen in ihre Verantwortung hinein, sofern sie auch wirklich an entscheiden- den Fragen beteiligt werden. Trostpflaster in direkter Demokratie, wie sie in Wien versucht wurden, scheitern. Damals durfte das Volk über die Einführung des Hundeführerscheins abstimmen. Da fühlten sich viele nicht ernst genommen.
Sie kennen das Argument, dass man dem Volk das Regieren nicht anvertrauen kann, mit dem Verweis auf die Weimarer Republik. Was macht Sie sicher, dass wir dieser Aufgabe intellektuell und charakterlich gewachsen sind?
Wenn ich Ihr Argument zu Ende führe, heißt das, die Menschen seien zu dumm, um Verantwortung zu übernehmen. Dann kann man die Demokratie abschaffen und eine Autokratie installieren. Ich halte dem die Erkenntnisse der Hirnforschung entgegen, die deutlich machen, wie wir psychisch erwachsen werden und wie daher ein Gesellschaftsmodell denkbar wird aus mündigen Bürgern, die ihren Aufgaben gewachsen sind.
So richtig überzeugt haben Sie mich noch nicht.
Das ist natürlich ein schrittweiser Prozess, der auf regionaler Ebene beginnen und dann langsam auf überregionale Belange übergehen sollte, anfänglich in beratenden, später in entscheidenden Abstimmungen. Der Schlüssel dazu ist Bildung. Wir müssen die Fallstricke unserer Psyche kennen und wissen, wie demokratische Entscheidungsprozesse ablaufen.
Ihr idealer Politiker verfügt über Mut, gesunden Narzissmus, psychische Belastbarkeit sowie charakterliche und moralische Integrität. Entspricht eher Armin Laschet, Olaf Scholz oder Annalena Baerbock diesem Anforderungsprofil?
Es wäre wohl etwas vermessen, wenn ich mir hier ein Urteil über die Charaktereigenschaften von Einzelpersonen erlaube, und ich will auch nicht den Wähler in seiner Entscheidungsfindung bevormunden. Aktuell ist ohne Frage die Krisentauglichkeit von besonderer Bedeutung.
Psychiater verfügen über Menschenkenntnis. Allein die Scheidungsrate zeigt, wie schlecht wir gemeinhin darin sind, den Charakter eines Menschen einzuschätzen.
Weil in der Verliebtheit das Gefühl regiert, vertrauen wir blind. In der Politik sollte eben nicht das Gefühl regieren. Wenn wir Kandidaten nach verstandesmäßigen, nachvollziehbaren Kriterien aussuchen, wissen wir, wer qualifiziert ist und wer nicht. Dabei kann es helfen, die Emotionen zu durchschauen, die ein Politiker in uns auslöst, denn oft verraten sie viel über seine wahren Eigenschaften.
SRF - Tagesgespräch: Rezepte gegen Politik ohne Hirn
Vortrag von Hans-Otto Thomashoff: Mehr Hirn in die Politik
Pressestimmen/ Rezensionen (Auswahl)
Ich suchte das Glück und fand die Zufriedenheit – Presse/Rezensionen
Den Geheimnissen der Lebenszufriedenheit auf der Spur, 20. April 2015
Von Joachim Bauer
Rezension bezieht sich auf: Ich suchte das Glück und fand die Zufriedenheit: Eine spannende Reise in die Welt von Gehirn und Psyche (Gebundene Ausgabe)
Worauf kommt es an, um den Weg zu einem gelingenden Leben zu finden? Dem Wiener Psychiater und Psychotherapeuten Hans-Otto Thomashoff geht es, ihrer Beständigkeit wegen, bewusst um ‚Zufriedenheit‘, und nicht etwa um das ‚wie er es sieht- nur flüchtige Glück. Der Reiz dieses lesenswerten Buches liegt darin, dass es bei seiner Suche nach den Geheimnissen der Lebenszufriedenheit das im Untertitel gegebene Versprechen einlöst, Erkenntnisse der modernen Neurobiologie und Psychologie erhellend miteinander zu verbinden. Dem Autor ist ein Brückenschlag geglückt: Einerseits macht das Gehirn den Menschen zu einem hinsichtlich seiner Sozialkompetenz einzigartigen Wesen. Andrerseits wird das Gehirn seinerseits durch soziale Erfahrungen geformt, es verändert sich unter dem Einfluss zwischenmenschlicher Beziehungserfahrungen fortwährend selbst.
Bezugspunkt des Buches sind die sogenannten sozialen Neurowissenschaften. Dieses noch junge Forschungsgebiet hat deutlich werden lassen: Gute Beziehungserfahrungen sind, vom ersten Lebenstag an, nicht nur ein psychologisches, sondern auch ein neurobiologisches Desiderat, denn sie sind die Voraussetzung für eine regelrechte Entwicklung des kindlichen Gehirns. Dass nicht nur die Psyche ‚also der subjektiv erlebte Aspekt unseres Daseins-, sondern auch das Gehirn gute zwischenmenschliche Beziehungen braucht, dieser Grundgedanke ist die Leitmelodie dieses Buches. Thomashoff belegt diese Position mit zahlreichen verständlich erzählten experimentellen Befunden. Um zum Ich zu werden, braucht der Mensch das Du. Die neurobiologischen Grundlagen für diese Erkenntnis, so zeigt der Wiener Psychiater und Psychotherapeut, sind in der Bauweise unseres Gehirns zu suchen, vor allem in der Funktionsweise des Limbisches Systems, des Belohnungssystems und des Systems der Spiegelneurone. Die beiden entscheidenden Komponenten der Lebenszufriedenheit sind, wie der Autor überzeugend darlegt, gelingende soziale Beziehungen und die Möglichkeit, als handelnder Mensch Wirkmächtigkeit, das Gefühl ‚Ich kann es!‘ zu erleben.
Reizvoll und kurzweilig ist die Lektüre des Buches vor allem da, wo Thomashoff, der auch als Psychoanalytiker ausgebildet ist, Freuds Konzepte auf den Prüfstand der modernen Neurobiologie stellt. Dass männliche Schafe, die sofort nach Geburt von Ziegenmüttern adoptiert wurden, bei der späteren Partnerwahl auf Ziegenweibchen bestehen, ist für den Autor nicht nur ein Zeichen für die Wirkmacht sozialer Erfahrungen als solche, sondern auch ein ‚augenzwinkernd eingeführter- Hinweis darauf, dass Freuds Ödipus-Komplex nicht als abgehakt angesehen werden darf. Aber auch komplexeren zwischenmenschlichen Phänomenen wie etwa dem des gegenseitigen Sich-Unterschiebens von Gefühlen geht das Buch, unter Rückgriff auf neurobiologische Mechanismen, auf den Grund. Fast jedermann kennt typische Situationen dieser Art, zum Beispiel dass jemand, der sich in gereizt-aggressiver Stimmung befindet, einen entspannten Mitmenschen solange in einen nervenden Dialog verwickelt, bis das arme Opfer selbst in eine gereizte Stimmung gerät, worauf der Täter sein Opfer zum Schuldigen der eigenen schlechten Laune erklärt.
Nicht nur den Voraussetzungen der Lebenszufriedenheit, auch den Ursachen chronischer Lebensunzufriedenheit geht Hans-Otto Thomashoff auf den Grund. Als Letztere identifiziert er zum einen chronische äußere oder innere Konflikte, zum anderen den ‚Zufriedenheitskiller‘ Depression, die ihrerseits als das Ergebnis von chronischem Stress und aufgestauter Aggression anzusehen sei. Voraussetzung, um allgegenwärtigen Zufriedenheitskiller zu entgehen, sei die Fähigkeit des Menschen, Einsicht in sich selbst zu gewinnen – hier bringt der Autor nicht nur die Lektüre guter Bücher wie des seinigen, sondern auch die Psychotherapie ins Spiel. Das Ziel müsse es dabei sein, eine innere Balance zwischen der Respektierung und Erfüllung emotionaler Bedürfnisse einerseits und deren Kontrolle andrerseits zu finden. Damit dies im Erwachsenenalter gelingen könne, komme es bereits im Kindesalter darauf an, das Frontalhirn ‚den neurobiologischen Sitz der Selbstkontrolle- zu trainieren. Thomashoff entlässt seine Leser mit der Ansage, dass es ‚ungeachtet der Wirkmacht unbewusster Prozesse- dem Menschen letztlich möglich sei, Willensentscheidungen zu fällen, und sie ‚hinreichende Aufklärung vorausgesetzt- so zu fällen, dass Lebenszufriedenheit möglich ist. Thomashoff ist ein überaus geistreiches, informatives und lesenswertes Buch gelungen.
JOACHIM BAUER
Ich suchte das Glück und fand die Zufriedenheit, 2014
Versuchung des Bösen – Presse/Rezensionen
„In lockerem Plauderton führt Thomashoff den Leser durch die Biologie, Chemie und Psychologie der Aggression und erläutert individuelle und gesellschaftliche Aggressionsmuster. Er deckt auf, wie der falsche Eindruck entstehen kann, dass es sich beim Aggressionsverhalten, um eine angeborene Eigenschaft handelt, buchstabiert aus, warum wir leicht in eine Spirale geraten, die aggressive Reaktionen als die einzig passenden erscheinen lässt, beschreibt gleich zwei Wege, dieser Eigendynamik zu entkommen: das Verringern von Stress und die Förderung der Selbstreflexion.“ Manuela Lenzen , Frankfurter Allgemeine Zeitung
„Man kann lernen mit Aggression umzugehen und destruktive in konstruktive Aggression umzuwandeln. Wie das funktioniert erklärt der Autor gut nachvollziehbar. Erklärt werden auch die Ursachen für pathologische Aggression. Nicht selten werden Traumen (sie führen zu Extremstress) über Generationen hinweg in ewigen Opfer-Täter-Ketten weitergereicht, wenn es nicht zu einer Unterbrechung dieses Kreislauf kommt. Der Zusammenhang zwischen Trauma, Aggression und Depression wird im Buch deutlich geschildert. Bleibt festzuhalten, dass ein zufriedener Mensch nicht gewalttätig ist. Mittels verschiedener Strategien, wie etwa Aggressionen konstruktiv zu nutzen, Gewöhnungen zu meiden , Spaltungen vorzubeugen und zu überwinden, Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen, prosoziales Verhalten zu belohnen und vieles andere mehr ist es möglich der Aggressionsspirale zu entkommen. Wir alle sind gefordert. Dr. Dr. Thomashoff leistet einen erhellenden Beitrag dazu.“ Helga König bei amazon.de
„Ich empfehle dieses Buch für Erziehung und Unterricht als lustvolle Pflichtlektüre, weil es sowohl Eltern und Lehrer als auch ältere Schüler in die Komplexität dieses wichtigen, jeden von uns betreffenden Themas Aggression einführt. Der Autor tritt nicht nur für die Überwindung von primitiven Spaltungen ein, er führt sie uns auch vor Augen, wenn er sehr oft ein ODER durch ein UND ersetzt: nicht Darwin (alles Mutation und Selektion) oder sein Gegenspieler Lamarck (alles Umweltanpassung) sondern: wie ergänzen sich die Theorien beider? Nicht Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie, sondern wann ist welche Therapie angezeigt? Vereinfachungen sind bei einem so viele Ansätze berücksichtigenden Projekt notwendig und erleichtern unser Verständnis. Dass es sich trotzdem um ein komplexes Phänomen handelt, geht aus dem Aufzeigen von Forschungslücken und von komplizierten Zusammenhängen deutlich hervor. Auch wenn man in vereinzelten Punkten vielleicht nicht ganz die Meinung des Autors teilt, so ist doch seine klare persönliche Stellungnahme hilfreich für eine Präzisierung oder Erweiterung der eigenen derzeitigen Ansicht. Der persönlich gehaltene Stil macht die Lektüre ebenfalls reizvoll und amüsant; so kann ich z.B. kaum mehr auf der Straße einen Dackel sehen, ohne an Thomashoffs Dackeldame zu denken, die in einem Tierpark mit nahezu menschlichem Starrsinn die Existenz eines Geparden durch hartnäckiges Wegdrehen des Kopfes verleugnete: Katzen groß wie Doggen, das durfte nicht sein. Drehen wir nicht auch oft den Kopf weg, wenn uns missfällt oder ängstigt, was wir sehen? Mein Hauptargument für dieses Buch ist, dass es Lust darauf macht, unsere Intelligenz zu nützen, und etwas Besseres kann man wohl von keinem Buch sagen. So verbindet es bewusst, was ohnehin zusammengehört: Emotion und Verstand. In einer Lesepause bin ich mit meiner Katze in Verhandlung getreten und habe ihren Holzkeil, mit dem sie gern spielt, gegen eine noch attraktivere Staniolpapierkugel getauscht und mit dem Keil die Balkontür angehoben, sodass das Schloss nimmer klemmte und ich frische Luft hereinlassen konnte und Frustration und Ärger verschwanden.“ Sylvia Zwettler-Otte bei amazon.de
„Der Wiener Psychoanalytiker Hans-Otto Thomashoff hat ein in mehrfacher Hinsicht bahnbrechendes Buch zum Problem der Aggression geschrieben. Wir haben in diesem Feld die Situation einer wissenschaftlichen Zersplitterung mit verschiedener spezialisierter Forschung, die jeweils ihre Thesen generalisiert. Darum ermöglicht nur eine interdisziplinäre Behandlung des Themas ein Abwägen der Gesichtspunkte, wodurch manche Fragen, die durch die genannten Generalisierungen kompliziert und unlösbar erscheinen einer überraschend einfachen Lösung zugeführt werden können. Interdisziplinär ist hier in einem sehr weiten Sinne gemeint und realisiert: es werden sowohl die Beobachtungen der Verhaltensforschung, der Hirnforschung und der Entwicklungspsychologie berücksichtigt, wie auch der historischen und psychohistorischen Forschung, der Psychoanalyse, der Epidemiologie der Gewalt und etlicher weiterer Forschungsfelder. Alle haben entscheidendes zum Verständnis des Aggressionsproblems beigetragen, das aber nur in einer integrierenden Zusammenschau, wie dieses Buch sie leistet, wirklich erfasst werden kann.“ Ludwig Janus, ISPPM
„Sind wir Menschen von Natur aus böse oder werden wir erst dazu gemacht? Mit dieser spannenden Frage hat sich der Psychiater, Therapeut und Kunsthistoriker Hans-Otto Thomashoff intensiv auseinander gesetzt und seine Erkenntnisse jetzt in dem Buch „Versuchung des Bösen. So entkommen wir der Aggressionsspirale“ (Kösel Verlag, 19,95 Euro) veröffentlicht. Thomashoff nimmt den Leser in seinem Buch mit auf die Reise zur dunklen Seite der Seele. Für seine Arbeit hat er neueste Forschungen aus Biologie, Chemie und Psychologie ausgewertet – und daraus die These entwickelt, dass Aggression nicht, wie bislang häufig angenommen, ein angeborenes Verhaltensmuster ist, sondern als eine Reaktion auf Stress entsteht. Durch belastende Erfahrungen im Mutterleib und in der Kindheit – etwa in Kriegssituationen, aber auch durch einschlägige Computerspiele und Kinofilme – kann die Bereitschaft zu aggressivem Verhalten im Menschen fest verankert werden.“ Welt am Sonntag
Versuchung des Bösen, 2009
Mehr Hirn in die Politik, Kronenzeitung 8.9.2024